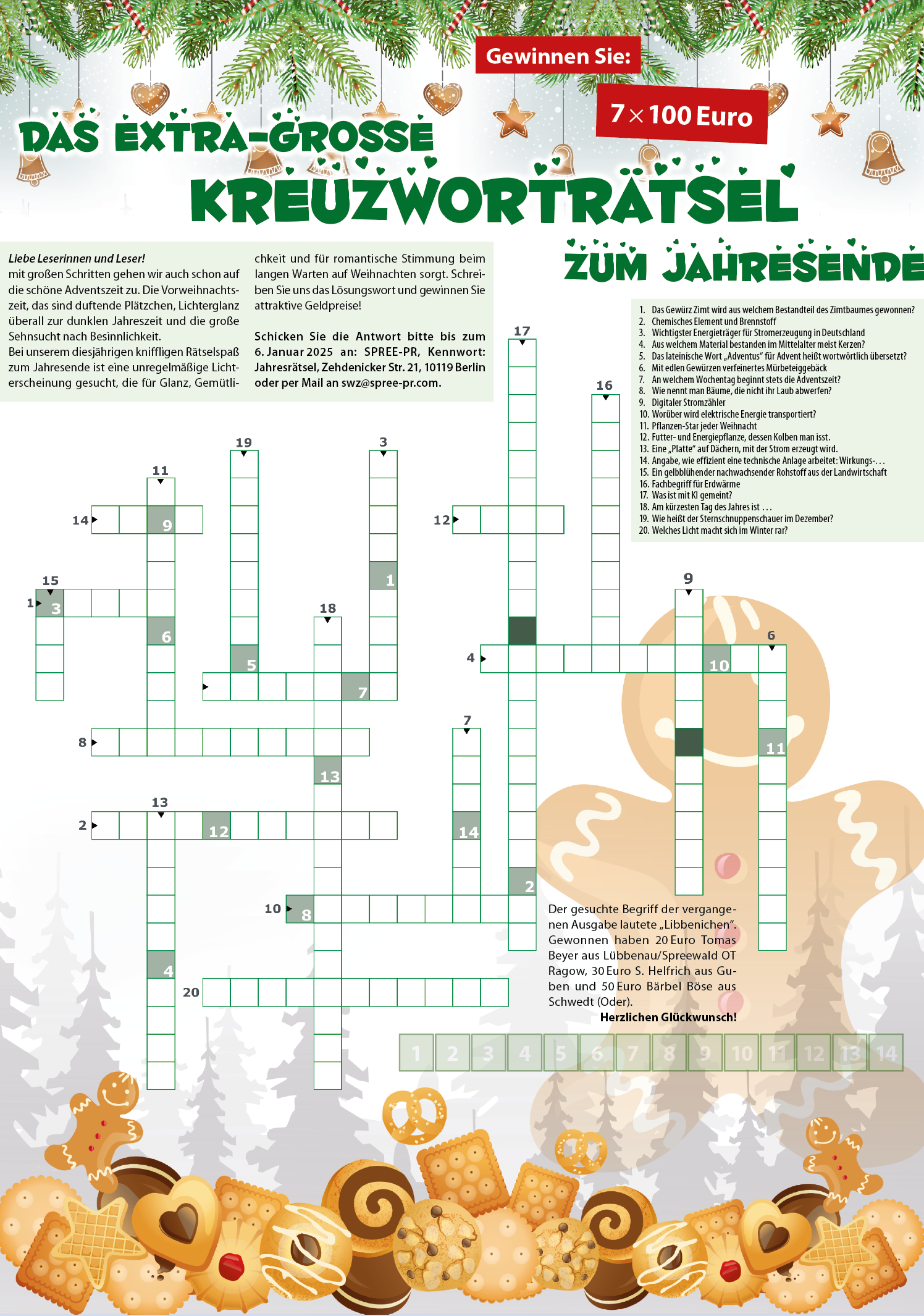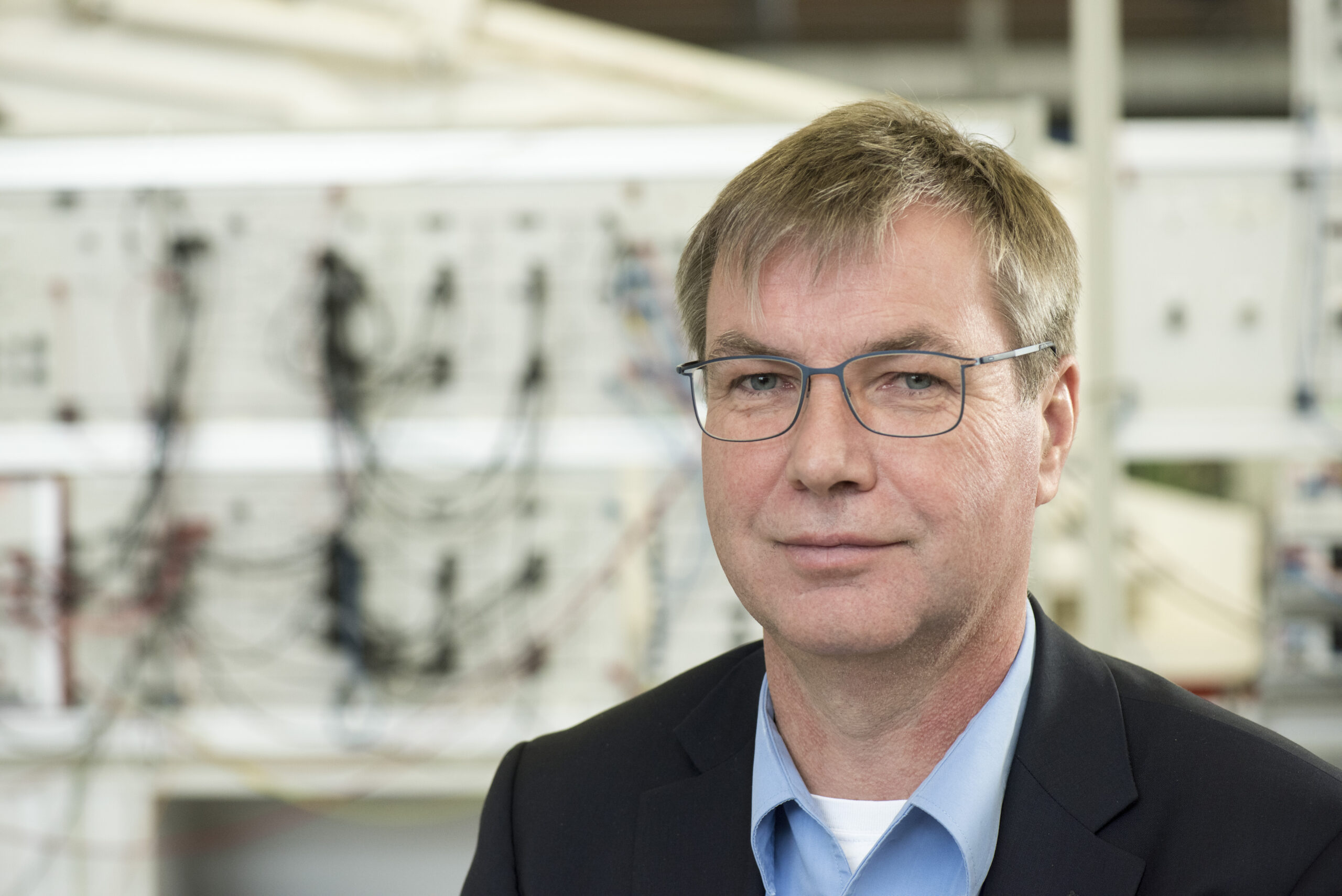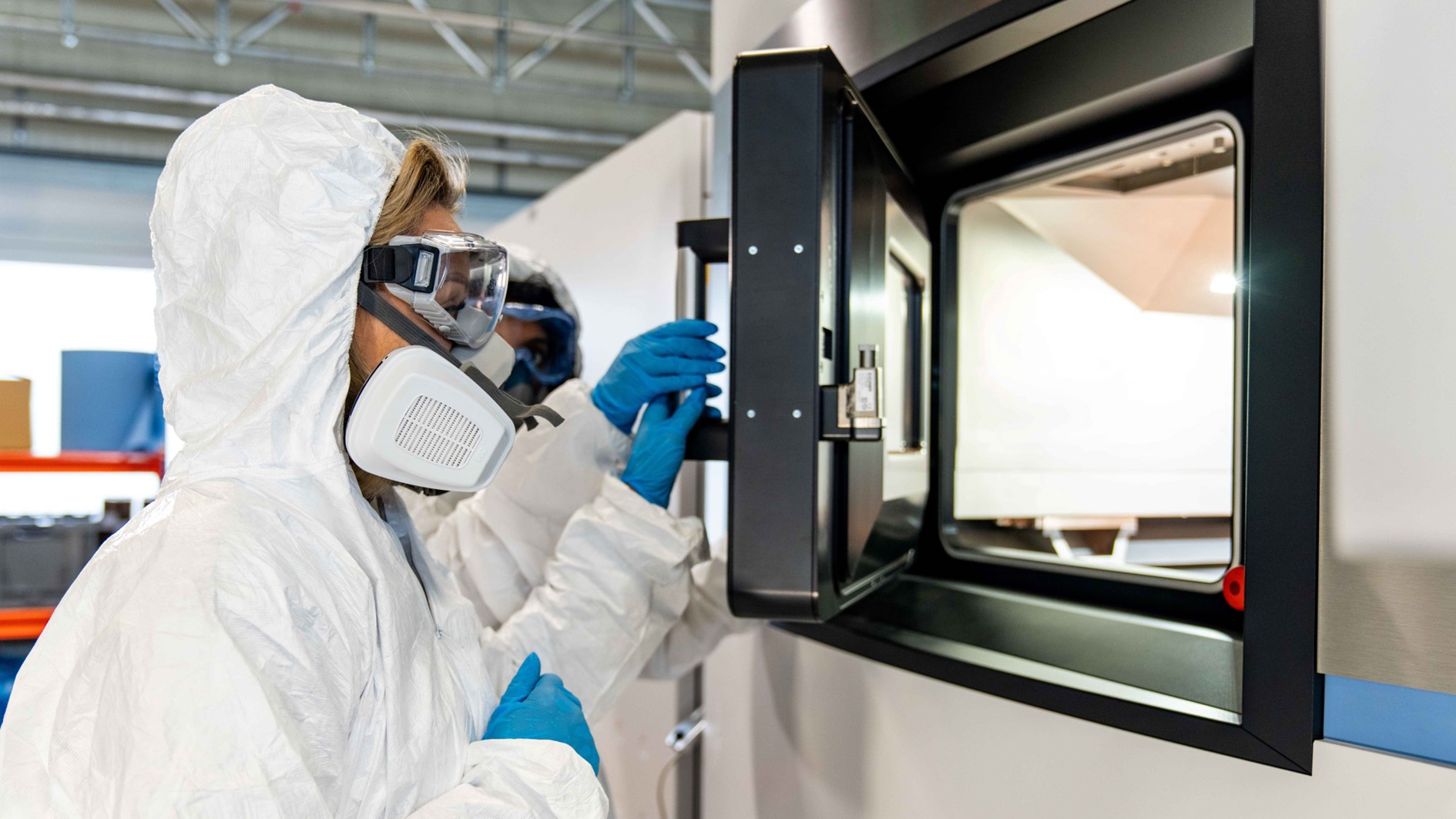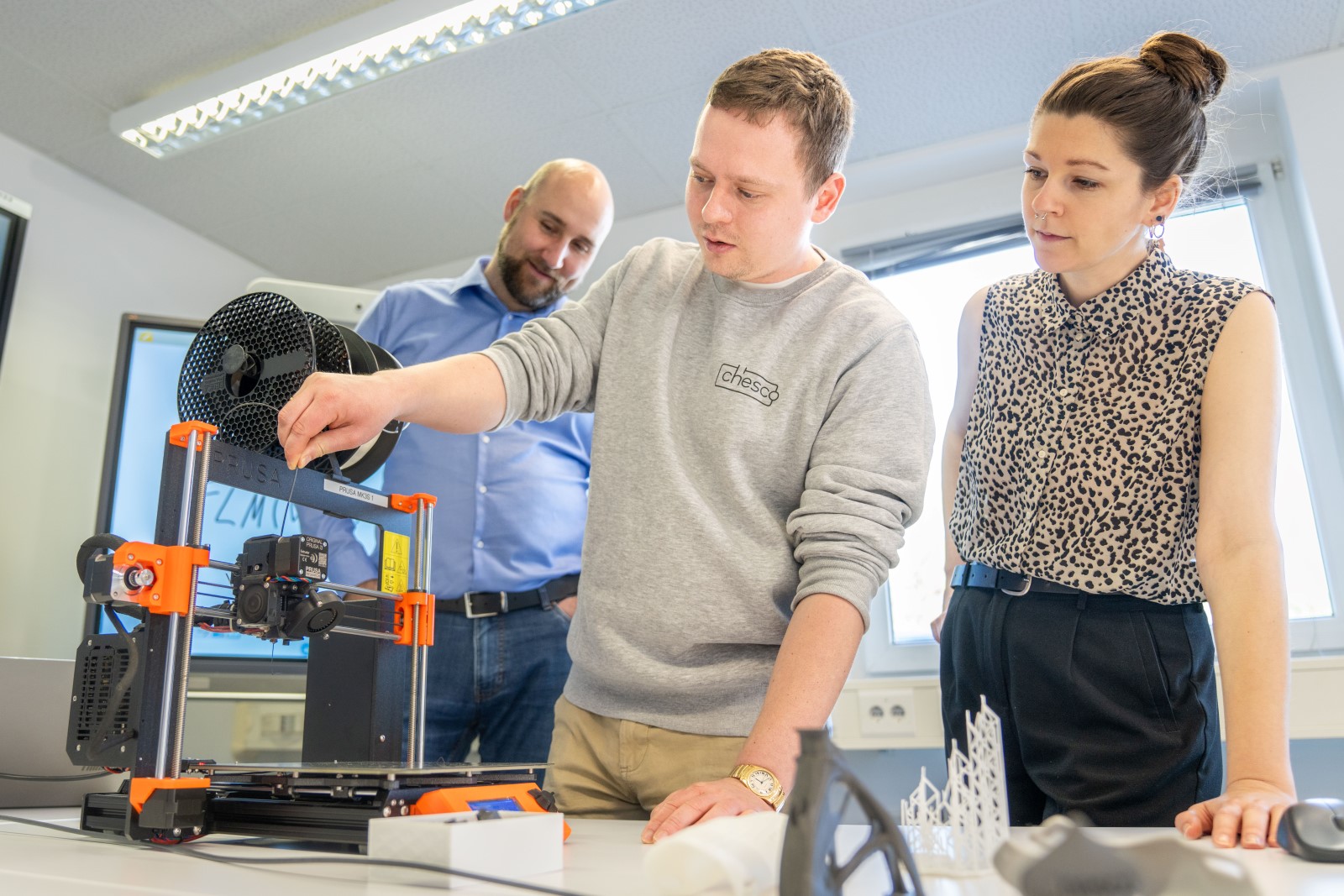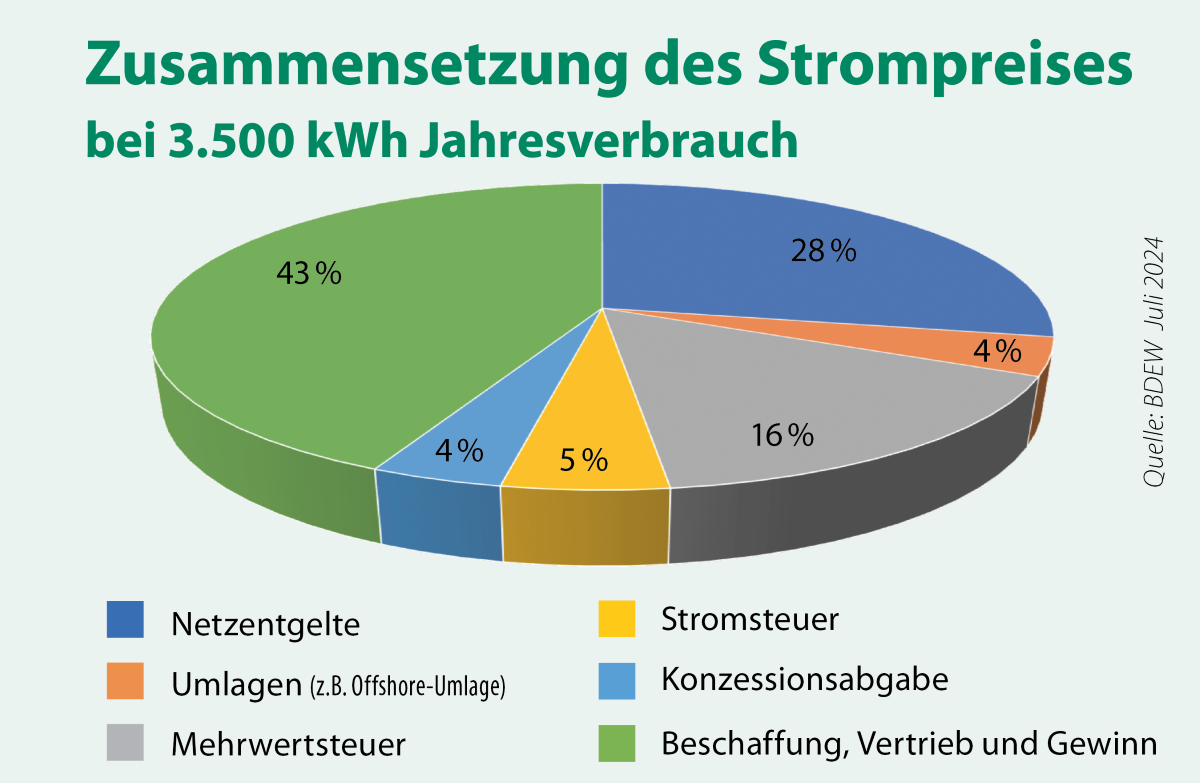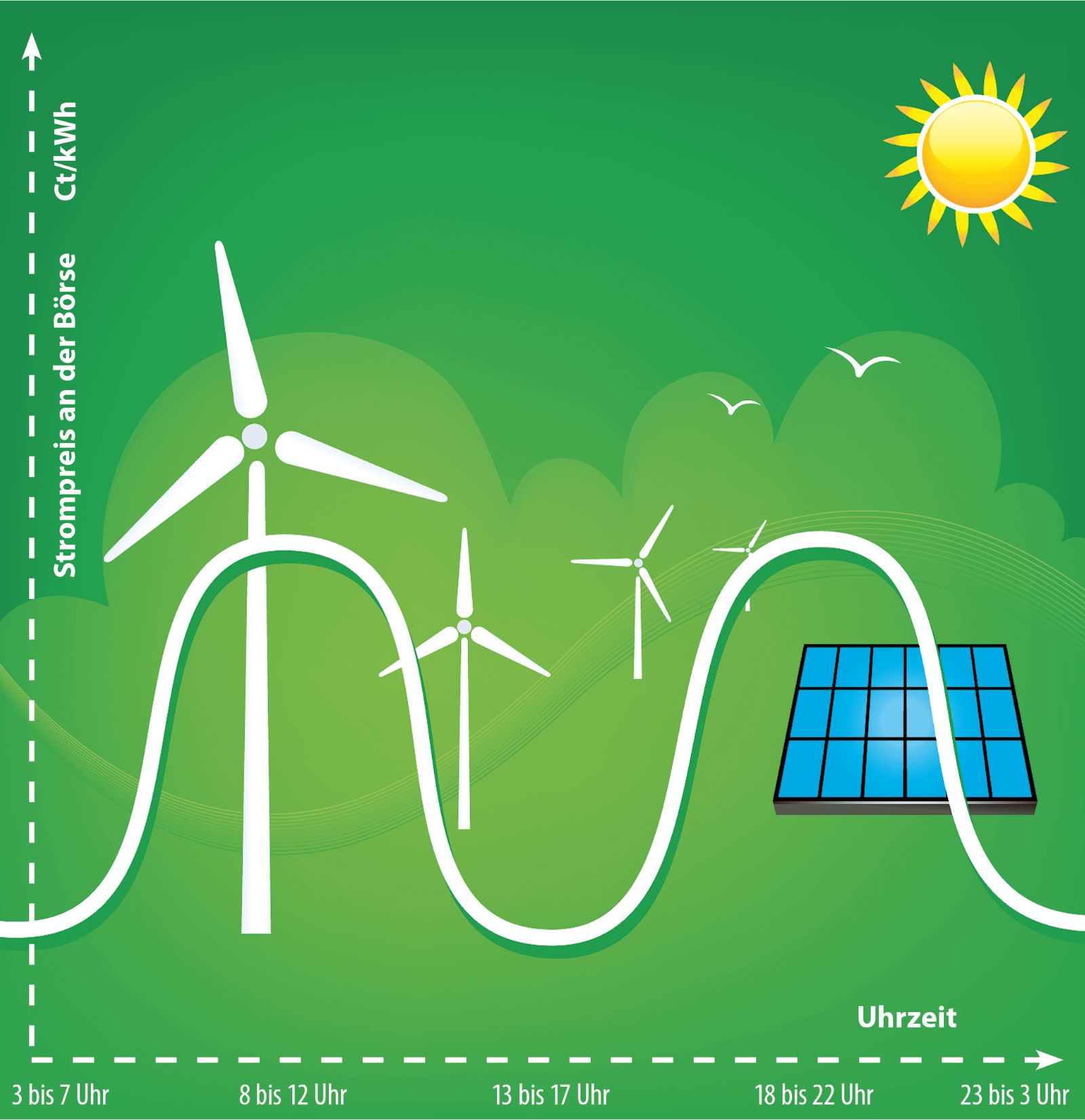Zunächst einmal, was erklärt den Trend Floating-PV? Spielen Verfügbarkeit von Freiflächen und Landnutzungskonflikte in der Landwirtschaft eine Rolle?
Dr. Karolina Baltins: Also das ist tatsächlich so. Die Ausbauziele hinsichtlich der Solarenergie sind ganz klar definiert. In Deutschland sollen bis 2030 etwa 215 Gigawatt Peak installiert werden. Das ist das Fünffache von dem, was bis Ende 2023 installiert wurde. Schauen wir bis 2040; bis dahin soll die PV-Leistung von 215 auf 400 Gigawatt-Peak steigen. Das sind beeindruckende Zahlen und Flächen. Wir werden nicht umhin kommen, weiterhin große Solarparks zu installieren, um unsere Ziele zu erreichen. Technologien wie Floating-PV (FPV) unterstützen letztendlich diese Pläne und können einen wichtigen Baustein im Gesamtkonzept für die Energiewende darstellen. Im Gegensatz zu Solaranlagen auf dem Festland beansprucht FPV keine Flächen, die für die Lebensmittelproduktion genutzt werden könnten. Zudem ermöglicht diese Technologie eine sinnvolle Nutzung der zahlreichen Seen, die durch den Kohleabbau oder die Kiesgewinnung entstanden sind und weiterhin entstehen.
In der Potenzialanalyse wurde untersucht, wo schwimmende Solarparks in Deutschland möglich seien. Wie sind Sie da herangegangen?
Die Potenzialabschätzung dient als Grundlage, um mögliche Einsatzgebiete für FPV-Systeme in Deutschland zu identifizieren und erste Einschätzungen zur Nutzbarkeit zu liefern. Wir haben für die GIS-Analyse die künstlichen Seen in Deutschland betrachtet. Zunächst haben wir aus den Geoportalen der verschiedenen Bundesländer sowie hauptsächlich aus OpenStreetMap die Informationen zu Gewässerflächen zusammengesucht und nur diese mit mindestens einem Hektar Größe für weitere Analysen betrachtet.
Das waren über 6.000 künstliche Gewässer in Deutschland mit einer Fläche von über 90.000 Hektar. Herausgerechnet wurden ebenfalls Wasserflächen mit Schutzgebieten wie Naturschutzgebieten und zur Wasserversorgung. Dann wurden die technischen Potenziale und technischen Einschränkungen betrachtet. Das sind die Mindesttiefverschattung oder der Abstand zum Ufer. Gesetzliche Vorgaben wie durch das Wasserhaushaltsgesetz schreiben eine maximale 15-prozentige Gewässerbelegung und 20 Meter Abstand zum Ufer vor. Anhand der Kriterien wurde die mögliche zu gewinnende Energie nach verschiedenen Ausrichtungen der Anlage berechnet. Dann sind wir einen Schritt weitergegangen als die bisherigen gesetzlichen Vorgaben und haben auch eine Gewässerbelegung von 25 % und 35 % angeschaut.
Was waren die Ergebnisse?
Deutschland hat ein großes Potenzial für schwimmende Photovoltaik. Von bisher 21 Megawatt Peak (MWp) installierter und 62 MWp in Genehmigung oder Konstruktion befindlicher PV-Leistung sind weitere 1,8 Gigawatt Peak (1 Gigawatt entspricht 1.000 Megawatt) in Südausrichtung möglich beziehungsweise 2,5 Gigawatt Peak (Ost-Westausrichtung) PV-Leistung, die auf Deutschlands künstlichen Seen installiert werden könnte. Um noch mehr Gewässerfläche für Solar zu nutzen, müsste die 15 -Prozent-Regelung gelockert werden.
Welches Potenzial hat denn Brandenburg?
Was die Anzahl der Gewässer (theoretisches Potenzial) betrifft, steht Brandenburg hinter Sachsen, Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen an fünfter Stelle bundesweit. In Brandenburg handelt es sich dabei überwiegend um viele kleinere Flächen. In Bezug auf die Anzahl der Wasserflächen belegt Brandenburg den 3. Platz. Hinsichtlich der Fläche in Hektar, den 5. Platz. Bezüglich einer zu erwartenden PV-Leistung rangieren Sachsen und Brandenburg unter den Bundesländern mit den höchsten Potenzialen.
Wie sieht es mit der Akzeptanz bei Floating-PV aus?
In Regionen, die sehr lange in der Historie schon ihre Ressourcen zur Energiegewinnung zur Verfügung gestellt haben, wird auf das Thema natürlich empfindlicher reagiert. Die größten Bedenken sind tatsächlich der Einfluss auf das Gewässer und auf die Gewässerökologie. Wasser ist unser wertvollstes Gut und Deutschland wählt bei der Regulierung neuer Technologien meist den vorsichtigeren Weg und lockert erst bei entsprechendem Wissensstand. Eine schwimmende Solaranlage schattet einerseits den darunterliegenden Teil des Sees ab und verändert andererseits die Windverhältnisse an der Oberfläche. Beides kann die Durchmischung des Gewässers beeinflussen, was wiederum die Nährstoffkonzentrationen im Wasser verändern kann. Bis jetzt konnte aber in diesem Bereich nicht nachgewiesen werden, dass es bei einer PV-Belegung auf Seen, die wir jetzt in Deutschland haben, einen negativen Impakt gibt. Es gibt auch positive Einflüsse von Floating-PV, wie der Schutz vor Wasserverdunstung. Oder Stichwort Algenwachstum, letztendlich kommt es zur Abschirmung von der direkten Sonneneinstrahlung des Gewässers. Das kann auch zum Beispiel helfen, dass das Gewässer sich nicht so stark aufwärmt. Positiv kann sein, dass die Anlage einen Schutz für die Fische im Gewässer bietet. Negativ, dass sich ein Kormoran auf die Anlage setzt. Aber deswegen sagen wir auch, dass in diesem Bereich noch jede Menge Forschung notwendig ist. Und da ist Deutschland wirklich sehr weit vorne.
Vielen Dank für das Gespräch!